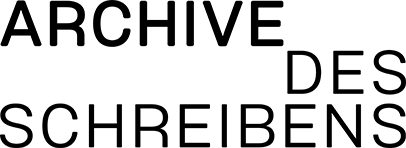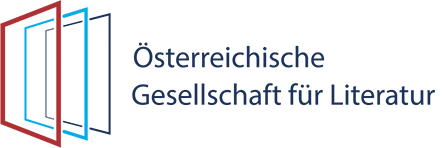»Ukrainische Bibliothek« gegen Putins Propaganda
Erstausstrahlung im ORF: 3. November 2025
Erstveröffentlichung auf ORF Topos: 11. November 2025
Seit Jahren lebt sie in Wien, spätestens seit ihrem Gewinn beim Bachmannpreis-Wettlesen 2018 ist sie auch in der deutschsprachigen Literaturwelt ein Begriff: die Ukrainerin Tanja Maljartschuk. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs bezeichnete sie sich als gebrochene Autorin, die ihr Vertrauen in die Sprache verloren hat. Aktuell gibt sie eine Reihe ukrainischer Klassiker in Übersetzung heraus, um der Abwesenheit ukrainischer Kultur – und damit auch der russischen Propaganda – entgegenzuwirken.
In ihrer Klagenfurter Rede zur Literatur, gehalten zum Auftakt des Wettlesens zum Bachmannpreis 2023, sagte Maljartschuk, sie sei eine gebrochene, eine ehemalige Autorin. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, in der Maljartschuk 1983 geboren wurde und bis 2011 lebte, habe ihr deutlich gemacht, dass »das Hauptinstrument aller Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die Sprache, die die schönsten Gedichte hervorbringt«, auch dazu dienen kann, »Befehle kundzutun, zum Abschuss von Raketen, die Zivilisten töten, oder zum Vorrücken von Panzern«.
Beim Aufeinandertreffen der Realität mit der Literatur, so die bittere Pointe der Rede mit dem Titel »Hier ist immer Gewalt. Hier ist immer Kampf«, gewinne immer die Realität. »Sie (die Literatur, Anm.) ist schön, aber hilflos wie ein Wald der blühenden Bäume. Was sie vielleicht kann: den Opfern in dunklen Tälern eine Stimme geben, bei Schreien und beim Schweigen zuhören, sie stärker machen, damit die Umbringer, Auslöscher, Verbrecher und Gauner, all jene, die überzeugt sind, mehr Recht zu haben und besser zu sein als die anderen, endlich nicht mehr die Oberhand behalten.«

Eine Bibliothek der Ukraine
Seit Beginn des Angriffskriegs 2022 behauptet die russische Propaganda wiederholt, die Ukraine sei keine eigenständige Nation, die Ukrainer würden gemeinsam mit Belarussen und Russen ein Volk bilden. Die fehlende Sichtbarkeit ukrainischer Kultur arbeite diesem Narrativ zu, so Maljartschuk. Die von ihr und der Übersetzerin Claudia Dathe neu gegründete ukrainische Klassikerbibliothek, die bis 2027 in acht Bänden das Erbe der ukrainischen Literatur durchmisst, beweist das Gegenteil: Aktuell stellt Maljartschuk in Veranstaltungen die beiden ersten Bände im deutschsprachigen Raum vor, zum Nationaldichter Taras Schewtschenko (1814-1861) und zur wichtigsten Autorin des ukrainischen Fin die Siécle, Lesja Ukrajinka (1871-1913). Sie macht damit eine Tradition sichtbar, die bisher in deutscher Übersetzung nicht greifbar war.
Im »Archive des Schreibens«-Gespräch verrät Maljartschuk, die sich als »wienerisch-ukrainisch« bezeichnet, warum sie ihre neue Heimat Wien liebt: Als sie den Ausdruck »ein Arsch mit Ohren« gelernt habe, wusste sie, dass sie ein Land, in dem solche Sprachbilder existieren, lieben müsse. Ihr eigenes Schreiben und Denken ist stark durch die Möglichkeit ihrer Zweisprachigkeit geprägt. Wie schnell sie sich literarische Meisterschaft auch auf Deutsch erschrieben hat, zeigt, dass sie bereits vier Jahre nach ihren ersten auf Deutsch geschriebenen Texten mit »Frösche im Meer« den Bachmannpreis 2018 gewann.
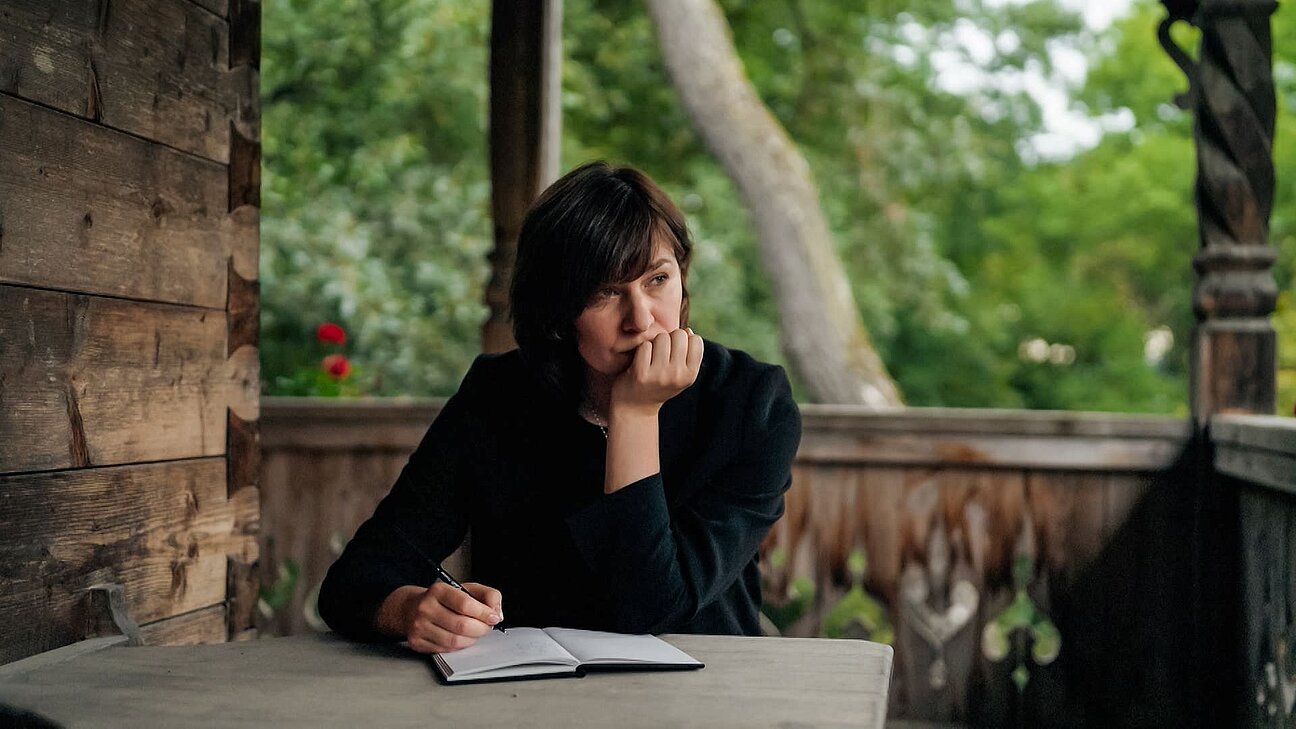
Politisches im einzelnen Leben
»Erst in Österreich habe ich angefangen, Romane zu schreiben. Erst in Österreich habe ich verstanden, dass ich Schriftstellerin bin. Hier ist der Status von Literatur ein anderer«, war damals ihre Reaktion auf den Preis. »Frösche im Meer« handelt von dem Migranten und Hilfsarbeiter Petro, der sich mit einer dementen alten Frau anfreundet, die er im »Froschpark« einmal kennengelernt hat und dort eines Tages vermisst. Er sucht sie auf, kümmert sich um sie und wird von Frau Grill für ihren Ehemann gehalten. Sein letzter Besuch verläuft allerdings ganz anders als erwartet, als schließlich die Polizei auftaucht. Petro hat keine Papiere. Das Ende bleibt offen.
Das Politische mischt sich in Maljartschuks Literatur stets mit dem Leben, das lässt sich auch in »Blauwal der Erinnerung« beobachten, Maljatschuks 2016 auf Ukrainisch erschienenem Roman, der 2019 in der Übersetzung von Maria Weissenböck erschien. Darin erzählt sie die Geschichte des vergessenen ukrainischen Volkshelden Wjatscheslaw Lypynskyj, einem Politiker und Philosophen, der erst als ukrainischer Botschafter in Wien lebte und später als Exilant in Österreich blieb.
Im Roman durchlebt die Ich-Erzählerin eine große persönliche Krise, die sich in einer Angststörung niederschlägt, die sie daran hindert, ihre Wohnung zu verlassen. Nur ihre historischen Recherchen zu Lypynskyj geben ihr Halt. Möglicherweise lässt sich ja Maljartschuks formulierte Skepsis an der Wirkmacht der Literatur gegenüber der Realität in der eingangs erwähnten Rede anhand ihres eigenen Romans entschärfen.
Der Trost für die Einzelne, den Literatur und Kultur birgt, darf als kleiner Sieg gegen die Resignation gelten. Wächst die Masse dieser kleinen Siege an, vermag sie vielleicht auch gegen eine unerbittliche Realität etwas auszurichten. Schließlich, so Maljartschuk im »Archive des Schreibens«-Gespräch, will »jeder, der schreibt, etwas bewegen«. Angesichts des Kriegs in der Ukraine denkt sie selbst neben der Herausgabe der Ukrainischen Bibliothek »mehr und mehr daran, dass ich einfach nur Schreiben möchte«. Und so klingt ein neues Vertrauen in die Sprache Maljartschuks durch, mit dem der Realität begegnet werden kann.
Video: Sandra Ölz (Gestaltung), Bernhard Höfer (Kamera), Yannick Kurzweil (Produktion)
Text: Florian Baranyi/ Literaturhaus Wien
(alle für ORF Topos)
Links
ORF Topos
Die ukrainische Bibliiothek im Rahmen der BuchWien 2025
Die ukrainische Bibliothek im Wallstein Verlag
Tanja Maljartschuk bei Kiepenheuer und Witsch
Tanja Maljartschuk bei Residenz
Tanja Maljartschuk bei Edition FotoTAPETA
Tanja Maljartschuks ›Archive des Schreibens‹-Playlist
GANNA: »Vesna (feat. Grycja)«
GANNA: »ZEMLYA«
Natalia Tsupryk: »The Trees Will Swing (І Загойдають Дерева)«